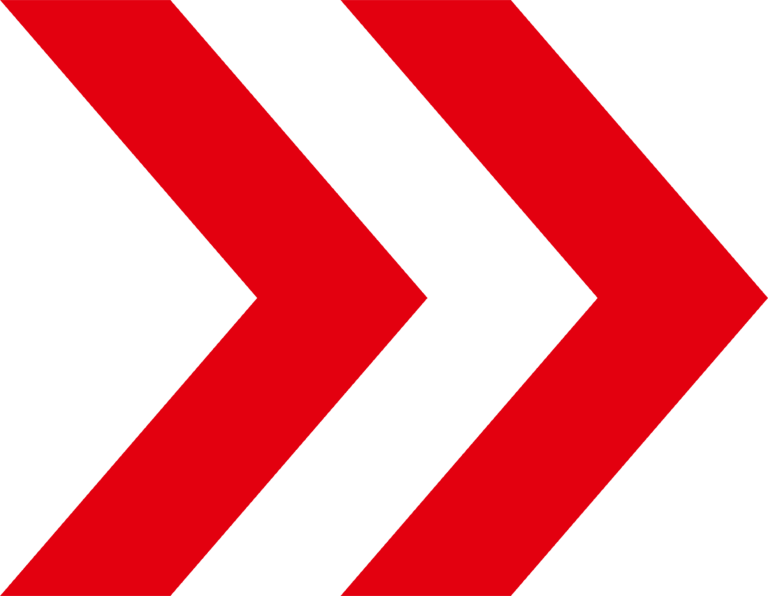Wir beantragen: Die anstehende Fortschreibung der kommunalen Wärmeplanung erfolgt mit der Zielsetzung, alle potentiellen Wärmenetzgebiete gemäß des neuen Wärmeplanungsgesetzes (WPG) des Bundes auszuweisen, wobei folgende Kriterien Berücksichtigung finden:
- Die Wärmeplanung wird auf die Topografie der Stadt Stuttgart zugeschnitten.
- Es werden alle Gebiete, die mindestens eine Wärmedichte von 400 MWh/(ha*a) aufweisen (bezogen auf die Arealfläche) bei der Ausweisung von Wärmenetzgebieten betrachtet.
- Die Wärmequellen Flusswärme aus dem Neckar und aus den Abläufen der Klärwerke Mühlhausen, Möhringen und Plieningen werden in vollem Umfang für die Wärmebereitstellung genutzt und ihr technisch nutzbares Potenzial ausgewiesen.
- Alle weiteren in Frage kommenden erneuerbaren Wärme- und Abwärmequellen wie Geowärme und Sonnenkollektoren im Stadtgebiet finden ebenfalls Berücksichtigung und werden hinsichtlich ihres Potenzials ausgewiesen.
- Es werden Konzepte für die Integration großer Wärmespeicher ausgearbeitet. Dies stellt eine wichtige Voraussetzung für einen stromnetzdienlichen Betrieb von Großwärmepumpen als abschaltbare Lasten und für die Nutzung zusätzlicher Wärmeerzeuger dar.
- Es wird ein quantitativer Wirtschaftlichkeitsvergleich (gemäß Leitfaden Wärmeplanung) zwischen zentralen und dezentralen Wärmeversorgungsoptionen dargestellt.
- Es werden alle bei der Planung genutzten Daten, die unter Berücksichtigung rechtlicher Rahmenbedingungen offengelegt werden können, und die angewandten Kriterien nachvollziehbar dargestellt.
- Die Bezirksbeirät*innen und die Öffentlichkeit werden in den Planungsprozess fortlaufend und aktiv eingebunden.
Begründung:
Die Frage, in welchem Ausmaß die netzgebundene Wärmeversorgung oder dezentrale Einzellösungen bei der Transformation der Wärmeversorgung berücksichtigt werden, ist ein entscheidendes Kriterium für die Optimierung und Effizienz des gesamten Energiesystems.
Die dichte Siedlungsstruktur in den 23 Bezirken der Landeshauptstadt hat vielfach hohe Wärmedichten zur Folge. Die räumliche Analyse zeigt, dass in Stuttgart fast 89 % des heutigen Wärmebedarfs in Gebieten liegen, die eine Wärmedichte von mehr als 400 MWh/(ha*a) aufweisen. In Mannheim mit einem Wert von lediglich 66 % werden am Ende 60 % aller beheizten Gebäude an das Fernwärmenetz angeschlossen.
Die in Stuttgart verfügbaren Wärmequellen, die bei klimaneutraler Wärmeversorgung die tragende Rolle spielen, können in großem Maßstab nur mit Hilfe von Wärmenetzen genutzt werden. Das gilt für die Flusswärme aus dem Neckar und für die oberflächennahe Geothermie, die vor allem in den Filder-Stadtbezirken und im Norden einen wichtigen Beitrag leisten kann. Auch die Nutzung der verschieden Abwärmequellen, wie Kläranlagen, Abwasserleitungen, Rechenzentren, Industrie, Großelektrolyseure etc. setzt Wärmenetze voraus und ergänzen sich in idealer Weise.
Mit immer größer werdendem Anteil von Wind- und Solarstrom wächst auch der Umfang fluktuierender Stromerzeugung. Deshalb muss das zukünftige Energiesystem sehr flexibel gestaltet werden, um Stabilität und Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Es bedarf einer engen Sektorenkopplung u. a. zwischen Strom und Wärme; groß dimensionierte Wärmespeicher in den Wärmenetzen leisten hier einen wichtigen Beitrag. Dazu muss die Wärmeplanung mit der Netzausbauplanung gekoppelt und darauf abgestimmt werden. Wenn viel Wind- und Solarstrom im Netz ist, können Großwärmepumpen und Elektro-Spitzenkessel zu Zeiten niedriger Strompreise betrieben werden und sorgen so für Kosteneffizienz. Flexible, klimaneutral betriebene Blockheizkraftwerke in den Energiezentralen können bei geringer regenerativer Stromerzeugung Stromlücken füllen. Aus ökonomischer Sicht hat dies Vorteile, da die Strompreise dann hoch sind, was sich positiv auf die Stromerlöse der BHKWs auswirkt.
Im vorliegendem Wärmeplan vom Dezember 2023 sind als Akteure die Stadtwerke Stuttgart, die EnBW als verantwortliches Unternehmen für das Fernwärmenetz sowie die Betreiber der weiteren bereits bestehenden Netze benannt. Mittlerweile werden auch die ersten privaten Initiativen aktiv, die ihr Interesse bekunden, eigene Wärmenetze zu planen, zu bauen und zu betreiben. Es ist wichtig diese zivilgesellschaftlichen Gruppen von Anfang an zu unterstützen. Eine wichtige Grundlage dafür wird durch eine Wärmeplanung nach den oben beschriebenen Kriterien geschaffen. Damit stehen sofort alle Daten bereit, die von den privaten Projekten benötigt werden. Genauso von Bedeutung ist zudem die Einbindung der privaten Initiativen in einen konsistenten Rahmen, der die Transformation der Wärmeversorgung in der gesamten Stadt im Blick hat.
Die Potenziale in Stuttgart für die Wärmewende sind groß. Werden sie konsequent genutzt, kann die Landeshauptstadt aufgrund ihrer Größe einen wichtigen Beitrag zur Wärmewende in Baden-Württemberg leisten.
Gezeichnet
Celine Hirschka
Lucia Schanbacher
Stefan Conzelmann (Fraktionsvorsitzender)
SPD und Volt
Andrea Münch
Marcel Roth
Björn Peterhoff (Fraktionsvorsitzender)
Bündnis90/Die Grünen
Hannes Rockenbauch (Fraktionsvorsitzender)
Johanna Tiarks (Fraktionsvorsitzende)
Dennis Landgraf
Die Linke SÖS Plus